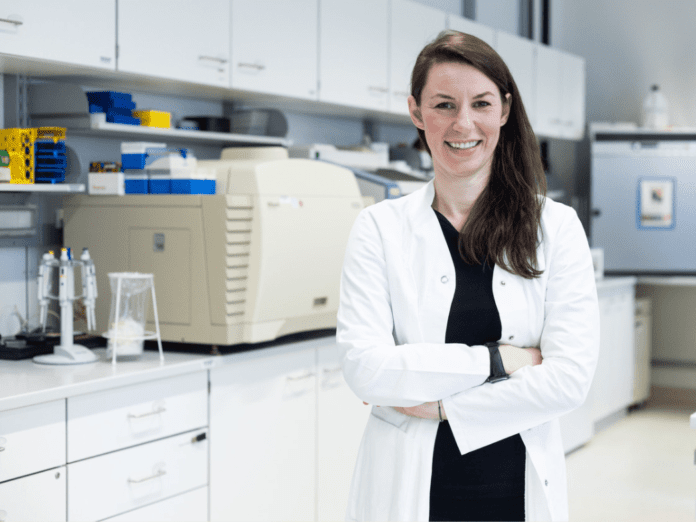Dr. Rebecca Herzog ist Forscherin im Gebiet der Nierenersatztherapie. Im Dezember wurde sie zum Researcher of the Month der MedUni Wien ernannt. Im Interview mit sheconomy erzählt sie, warum sich Durchhalten in der Forschung lohnt, welche Vorbilder sie geprägt haben und wie ihr Karriereweg aussah.
Frau Dr. Herzog, wie würden Sie einer Person, die nicht in der Forschung tätig ist, erklären, was Sie in ihrer Arbeit tun?
Dr. Rebecca Herzog: In meinem Forschungsgebiet geht es um die Verbesserung der Nierenersatztherapie. Nicht alle Patient:innen, die Nierenleiden haben, können vor dem Erreichen des Nierenversagens eine Transplantation erhalten. Das bedeutet, sie müssen meistens für eine lange Zeit an die Dialyse, das gilt sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Die Dialyse hat aber viele Nachteile. Es gibt zwei Arten, wir beschäftigen uns hauptsächlich mit jener, die eine bessere Vereinbarkeit mit dem normalen Leben zulässt, die Bauchfelldialyse. Man kann in die Arbeit gehen, die Universität besuchen und am täglichen Leben teilnehmen. Leider ist das aber nicht unbegrenzt möglich. Wir versuchen, die Dialyseart so zu verbessern, dass Patient:innen sie länger in Anspruch nehmen können und es gleichzeitig zu weniger Komplikationen kommt.
Es gibt für die Bauchfelldialyse also einen bestimmten Zeitraum, danach kann man sie nicht mehr machen?
Die Dauer kommt ganz auf auf die anatomischen und krankheitsbedingten Gegebenheiten des:der Patient:in an. Manche Patient:innen können das nur ein halbes Jahr, andere über zehn Jahre lang machen. Wir versuchen herauszufinden, wer gut dafür geeignet ist. Dadurch, dass wir auch an der Verminderung von Komplikationen arbeiten, haben Patient:innen viel länger Zeit, bevor sie die Hämodialyse, die zweite Dialyseart, machen müssen. Oder aber sie können die Zeit zur Nierentransplantation besser überbrücken.
Wie hat Ihr persönlicher Weg in die Forschung ausgesehen und wieso haben Sie sich genau für diesen Bereich entschieden?
Mein Weg in die Forschung hat schon früh im Studium begonnen. Eigentlich habe ich etwas studiert, das gar nichts mit Forschung zu tun hat, nämlich Biomedizinische Analytik. Diesen Bereich kennt man jüngst durch die Coronapandemie. Die Frauen, es sind nämlich über 75 Prozent Frauen, die diesen Beruf machen, die in einem Routinelabor die Blutproben analysieren oder die PCR-Abstriche machen, das alles zählt zu dieser Branche. Dazu ist eine dreijährige Berufsausbildung nötig, in der man im letzten Jahr eine Forschungsdiplomarbeit schreibt. Im Zuge dessen bin ich in ein Labor gekommen und habe realisiert, dass mich die Forschungsarbeit viel mehr als die Routinearbeit interessiert. Deswegen habe ich mich nach der Diplomarbeit dazu entschieden, nicht in die Routinediagnostik zu gehen, sondern in die Forschung und habe dann eine geteilte Stelle an der Kinderklinik der MedUni Wien und bei der Firma Zytoprotec gefunden. Ich arbeite einerseits an der Universität, bin aber auch Konsulentin und Angestellte bei Zytoprotec, die diese Verbesserungen der Bauchfelldialyse entwickelt. So bin ich in der Forschung gelandet, zunächst in der Forschungsassistenz und schließlich durch ein berufsbegleitendes Masterstudium in Biomedical Sciences und danach dem Doktorat der medizinischen Wissenschaften. Aktuell bin ich Senior-Post-Doc.
Ihr Job klingt sehr abwechslungsreich. Internationale Vorträge, die Lehrtätigkeit an der MedUni Wien und dann noch die Forschung selbst. Was mögen Sie denn am meisten an Ihrem Beruf?
Am allermeisten mag ich tatsächlich die Forschung an sich, das Stehen an der Laborbank. Wenn ich daran keinen Spaß hätte, könnte ich meine Arbeit nicht machen. Aktuell sind auch viele Auswertungen und das Schreiben von Publikationen dabei. Diese beiden Sachen gehören zur Forschung dazu, sie sind die Hauptfaktoren, die ich an meiner Arbeit schätze. In der Forschung ist es nicht so, dass man jeden Tag etwas Neues entdeckt. Im Gegenteil, oft findet man heraus, wie etwas nicht funktioniert. Dann man muss zurückgehen, nachdenken und einen neuen Ansatz finden oder aber das ganze Konzept nochmals überdenken. Vortragende zu sein gehört einfach dazu, das mache ich ebenfalls gerne. Dadurch hat sich auch die Lehre ergeben. Defacto ist das die Studierendenausbildung durch Vorträge und direkte Betreuung, auch das ist Teil einer Universitätskarriere. Ich wollte eigentlich nie Lehrende sein, es war nicht geplant. Jetzt gefällt es mir, Wissen weiterzugeben und ich kann mir gut vorstellen, das weiterzumachen, auch dann, wenn ich es nicht mehr unbedingt muss.
Was war bisher die größte Herausforderung in Ihrer Karriere?
Die größte Herausforderung ist tatsächlich, in der Forschung zu bleiben. Die Situation mit der Forschungsfinanzierung ist keine einfache, sowohl in Österreich als auch international gesehen. Während des Doktoratsstudiums gibt es meistens genügend Finanzierungen, man bewegt sich in einem geschützten Rahmen. Danach kommt allerdings ein Knackpunkt und damit die Herausforderung: Bleibt man in der akademischen Forschung oder nicht? Ich habe mich dafür entschieden, arbeite aber parallel auch im Christian Doppler Labor. Das ist eine Public Private Partnership, also Universitäts- und Grundlagenforschung gepaart mit einem kommerziellen Partner. Dadurch gibt es nicht nur mehr finanzielle Mittel, sondern man ist auch näher an den Patient:innen und der Entwicklungsarbeit dran.
Und was war Ihr schönster Erfolgsmoment?
In einer relativ gut finanzierten Forschung zu bleiben und gleichzeitig nah an den Patient:innen zu sein, ist in Wirklichkeit mein größter bisheriger Erfolg. Dadurch habe ich zum Beispiel auch einen Postdoc Grant erhalten, eine Förderung, die zu meinem ersten eigenen großen Forschungsprojekt im Rahmen des Christian Doppler Labors geführt hat. Gleichzeitig ist das auch die größte Herausforderung: Die Forschung nicht komplett zu verlassen, sondern diese Tätigkeit mit der Industrie, der Biotechbranche, zu vereinbaren. Die Forschungslandschaft ist nicht einfach zu erklären, kein Karriereweg gleicht dem anderen. Es gibt aber viele Ähnlichkeiten. Mein Weg ist eine Mischung aus akademischer Forschung und Industrie. Das finde ich toll, so habe ich das Beste aus beiden Welten. Aber auch die Schwierigkeiten beider Seiten. (lacht)
Sie haben vorhin schon angesprochen, dass in der Biomedizinischen Analytik viele Frauen tätig sind. In der Forschung und Entwicklung allgemein ist der Frauenanteil jedoch sehr gering. Laut einer Erhebung von Statista waren 2020 in Österreich 23,8 Prozent Frauen in diesem Bereich tätig, in Deutschland 22,7 Prozent. Andere EU-Länder schneiden weitaus besser ab, wie zum Beispiel Lettland mit 48,8 Prozent. Wie erleben Sie diesen Umstand in dem internationalen Part Ihrer Arbeit und was können wir Ihrer Meinung nach von anderen Ländern in dieser Hinsicht lernen?
In Österreich ist es tatsächlich so, dass Medizin eines der MINT-Fächer ist, in denen es vergleichsweise viele Studienanfängerinnen gibt. In den restlichen MINT-Studien liegt der Frauenanteil bei maximal 25 Prozent, das ist in der ganzen westlichen Welt so. Das ist nicht nur traurig, sondern auch ein Umstand, den man nicht so belassen kann. Das Problem ist, dass er sich viel zu langsam ändert. Wir haben das Problem der sogenannten Leaky Pipeline: Wir starten zwar in vielen Fächern mittlerweile mit über 50 Prozent Studienanfängerinnen, je höher aber das Qualifikationslevel steigt, umso kleiner wird der Frauenanteil. Das ist kein Motivationsloch, sondern eine kulturelle Geschichte. Was kann man dagegen machen? Das ist eine gute Frage. Es wurde in der Politik schon einiges getan, auch kulturell hat sich in den letzten 30 Jahren viel verändert. Das ist aber noch ganz klar zu wenig. Neue Berechnungen zeigen, dass wenn wir mit all den Verbesserungen, die wir jetzt haben, genauso weitermachen, es noch mindestens 50 Jahre dauert, bis ein 50-50 Anteil herrscht, der die Bevölkerung widerspiegeln würde. Es muss noch viel passieren, beispielsweise in der kulturellen Einstellung und dass die Kinderbetreuung nicht mehr nur als reine Frauensache angesehen wird, denn dadurch werden Frauen am Karriereaufstieg gehindert. Teilzeitarbeit ist möglich, auch in der Forschung, aber es wird zum Problem, wenn das hauptsächlich Frauen betrifft. Wenn man sich zum Beispiel den Frauenanteil bei Neuberufungen zu Universitätsprofessuren ansieht, sind die Zahlen katastrophal. Aber das ist nicht mein Forschungsgebiet, es gibt viele sozioökonomische Studien, die sich im Detail damit beschäftigen. Ich kann nur aus meiner Perspektive berichten, die genannten Umstände sind jene Gründe, die bei Frauen in meinem Umfeld zu einem Stehenbleiben bei einem gewissen Karrierelevel führen.
Role Models sind bei dieser Problematik ein wichtiger Faktor, um aufzuzeigen, wie es eben doch funktionieren kann. Hatten Sie Mentorinnen oder Vorbilder, die Sie während Ihrer Karriere motiviert und begleitet haben?
Ja, der Effekt ist mir aber erst viel später bewusst geworden. Ich hatte viel Glück als ich mich im Rahmen meiner Diplomarbeit für eine wissenschaftliche Stelle beworben habe. Meine direkte Betreuerin war eine Frau, die damals gerade habilitiert hat. Die Institutsleiterin war ebenfalls eine Frau. Meine beiden direkten Ansprechpersonen waren also zwei sehr erfolgreiche Frauen in der Forschung. Zu Beginn war das nichts Besonderes für mich, ich dachte mir nicht viel dabei. Erst als ich den Fachbereich wechselte und anfing, in der akademischen Forschung und der Biotechbranche zu arbeiten, habe ich gemerkt, wie die Realität aussieht. Seitdem sind alle meine Vorgesetzten Männer. Am Anfang habe ich das nicht so stark wahrgenommen, aber dieser Umstand hat sich in den letzten 15 Jahren nicht geändert. Ich weiß nicht, ob ich es für so selbstverständlich gehalten hätte, dass ich das alles auch erreichen kann, wenn nicht meine ersten beiden Betreuerinnen tatsächlich erfolgreiche Frauen in der Forschung gewesen wären.
Sie haben erwähnt, dass man in der Forschung viel Durchhaltevermögen benötigt. Was sind drei Eigenschaften, die man für eine Karriere in der Forschung mitbringen sollte?
Ein naturwissenschaftliches Grundinteresse muss vorhanden sein, zumindest für die Forschung in meinem Bereich. Dass man immer mehr wissen will und neugierig ist, das ist ganz wichtig. Die zweite Eigenschaft ist neben dem Durchhaltevermögen ein gesunder Umgang mit Misserfolg. 95 Prozent der Forschung sind Misserfolg, oder anders gesagt: Das Herausfinden, wie Dinge nicht funktionieren. Das ist schwierig, aber da muss man durchhalten, auch über längere Zeit hinweg. Drittens ist es wichtig, Spaß zu haben und die Forschung nicht nur als reine Arbeit anzusehen. Jede:r Forscher:in weiß, dass Forschung auch eine sehr persönliche Geschichte ist. Man diskutiert auch in der Freizeit darüber. Ich schalte das nicht einfach ab, wenn ich nachhause gehe. Wenn ich etwas Interessantes dazu lese, mache ich das auch außerhalb meiner Arbeitszeit. Niemand zwingt mich dazu, aber ich mache es, weil ich Freude daran habe. Diese Zusatzmotivation ist ein wichtiger Faktor, der sich absolut lohnt. Das Gefühl, etwas positiv zu verändern ist toll. In meinem Fall ist es der Umstand, dazu beigetragen zu haben, dass Patient:innen länger Zeit gegeben wird, um ein besseres Leben zu führen, als sie durch ihre Grunddiagnose haben. Dazu muss man aber durchhalten, denn diese Sachen gehen nicht schnell.